
Um den Eierstockkrebs zu besiegen, arbeiten Gynäkologie, Onkologie, Radiologie,
Strahlentherapie und Chirurgie Hand in Hand. Je nach individuellem Bedarf koordinieren die beteiligten
Netzwerkpartner die Überweisung in die jeweils benötigten Fachbereiche.
Eierstockkrebs ist die zweithäufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane. Pro Jahr erkranken rund 7.200 Frauen am sogenannten Ovarialkarzinom. Das durchschnittliche Alter der Patientinnen beträgt 68 Jahre, mit zunehmendem Alter steigt das Risiko weiter an. Bei mehr als zwei Dritteln der Erkrankten ist der Krebs zum Zeitpunkt der Diagnose bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Das liegt daran, dass das Ovarialkarzinom meist symptomlos bleibt, bis es sich in den Bauchraum ausgebreitet hat. Die Diagnostik beginnt deshalb im Idealfall mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Gynäkologen. Sollten beim Abtasten oder bei Ultraschalluntersuchungen Auffälligkeiten bemerkt werden, gilt es dem Verdacht weiter nachzugehen: Hier bietet sich eine Ultraschalluntersuchung der inneren Geschlechtsorgane an, die Aufschluss darüber gibt, ob eine unnatürliche Vergrößerung der Eierstöcke vorliegt. Weitere bildgebende Verfahren, wie eine Computertomografie des Bauch- und Brustraums, zeigen an, ob sich eine mögliche Krebserkrankung bereits weiter ausgebreitet hat. Erhärtet sich der Verdacht auf ein Ovarialkarzinom, folgt ein chirurgischer Eingriff, bei dem ein Eierstock ganz oder teilweise entnommen und durch den Pathologen histologisch untersucht wird. Erst mit dieser Probe kann einwandfrei ermittelt werden, ob wirklich Eierstockkrebs vorliegt und wenn ja, um welchen Tumortypen es sich handelt.

Das erklärte Ziel des chirurgischen Eingriffs ist es, den Tumor und das erkrankte Gewebe komplett zu entfernen. In den allermeisten Fällen bedeutet das, dass sowohl beide Eierstöcke, als auch Eileiter und Gebärmutter sowie das große Bauchnetz und Teile des Bauchfells entnommen werden müssen. Nur in sehr frühen Stadien und bei weniger aggressiven Tumoren ist eine die Fruchtbarkeit erhaltende Operation möglich, bei der ein Eierstock und die Gebärmutter unangetastet bleiben. Je nachdem, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, kann es erforderlich sein, auch Teile des Darms und des Blinddarms, der Milz, Leber oder Gallenblase zu entfernen. Der Eingriff ist aufwändig und belastend für die Patientinnen, zumal er zum jetzigen Stand noch nicht minimalinvasiv durchgeführt werden kann. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, sich für die Operation an eine spezialisierte Klinik zu wenden, die über die nötige Expertise und Infrastruktur verfügt. Je größer die Erfahrung der Chirurgen, umso größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass die restlose Entfernung des Tumors gelingt.
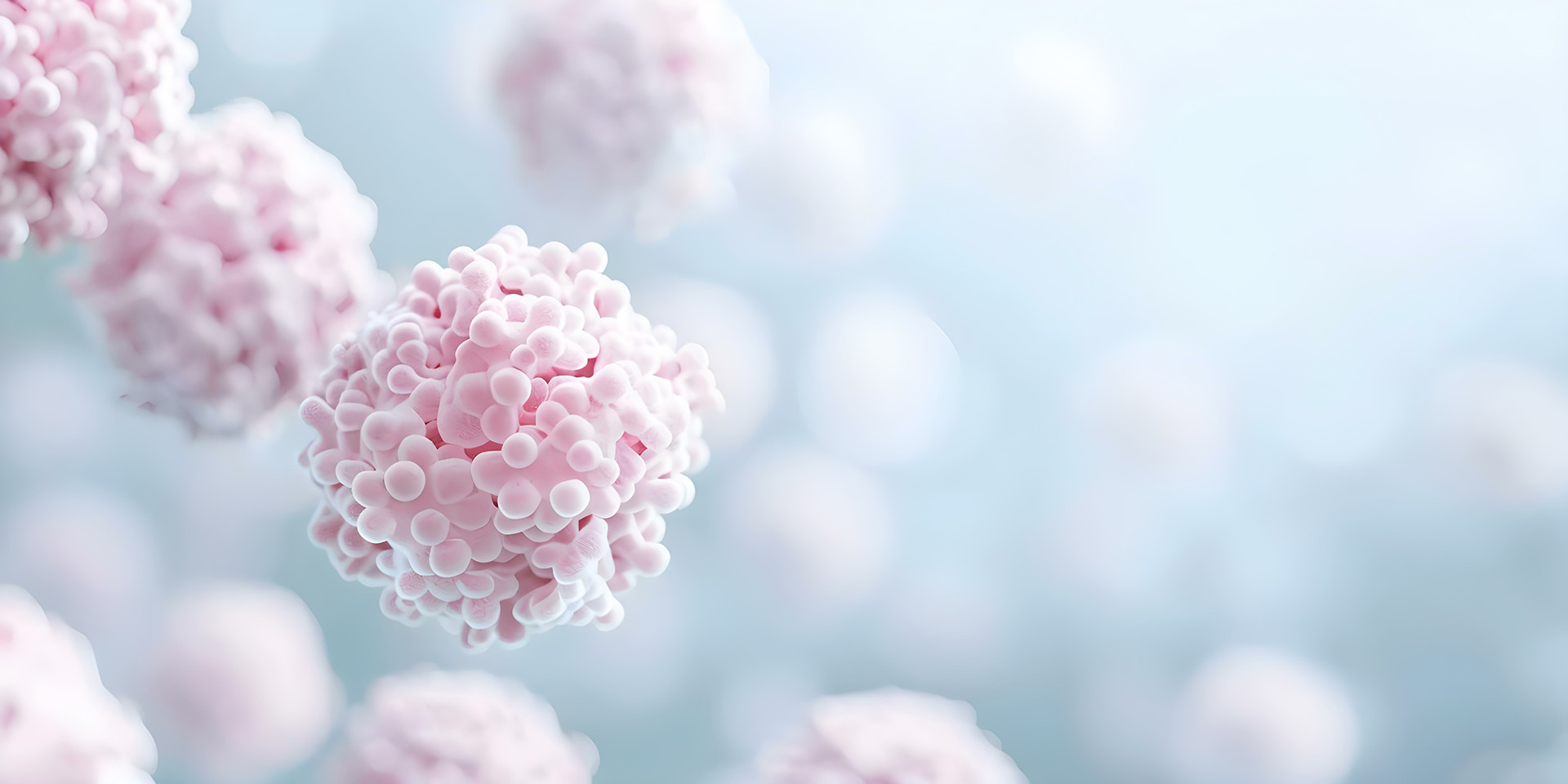
In den meisten Fällen der Erkrankung mit dem Ovarialkarzinom ist eine Chemotherapie nötig. Auf sie
kann höchstens in Frühstadien verzichtet werden. Die Chemotherapie verfolgt das Ziel, im Körper
verbliebene Krebszellen abzutöten. Üblicherweise werden dazu zwei Medikamente in Kombination
verabreicht und zwar insgesamt sechsmal in einem Abstand von drei Wochen. Im weiter fortgeschrittenen
Stadium des Eierstockkrebs empfehlen Experten zusätzlich zur Chemotherapie eine sogenannte
Erhaltungstherapie, die noch während der laufenden Chemotherapie beginnt. Der Patientin werden
Antikörper verabreicht, die die Blutgefäßbildung im Tumorgewebe unterbinden und damit das
Tumorwachstum verlangsamen.
Die Erhaltungstherapie dauert ca. 15 Monate, also deutlich länger
als die Chemotherapie. Bei bestimmten Mutationen kann durch den Einsatz sogenannter PARP-Inhibitoren
über 2 – 3 Jahre außerdem erreicht werden, dass Tumorzellen absterben.

Die Nachsorge nach einer Eierstockkrebs-Behandlung besteht im Wesentlichen aus zwei Bausteinen: einer Anschlussheilbehandlung oder Kur, die Erholung nach der anstrengenden Therapie bringen und den Heilungsprozess unterstützen soll, sowie der Tumornachsorge, regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, bei denen sichergestellt wird, dass es nicht zu einem Rückfall (Rezidiv) kommt. Diese Untersuchungen umfassen Arzt-Patienten-Gespräche, Tast- oder auch Ultraschalluntersuchungen. In den ersten drei Jahren nach der Behandlung findet diese Nachsorgeuntersuchung in der Regel alle drei Monate statt, in den beiden Jahren darauf halbjährlich und danach jährlich. Die Tumornachsorge wird durch den Frauenarzt in Abstimmung mit dem Eierstockkrebs-Netzwerk durchgeführt. Patientinnen, die infolge der Therapie unter Beschwerden wie Schmerzen, Schlafstörungen, Verdauungs- oder auch sexuellen Problemen leiden, finden dazu Hilfe in Selbsthilfe- oder Beratungsgruppen.
Je nach Auftreten des Rezidivs und dem Gesamtzustand der Patientin wird ein erneuter chirurgischer Eingriff vorgenommen, bei dem alles bösartige Gewebe entfernt und eine weitere Chemotherapie durchgeführt wird – gegebenenfalls mit einer anderen Medikamentenkombination. Bei stark geschwächten oder durch andere Erkrankungen vorbelasteten Patientinnen, besteht die Möglichkeit, auf eine erneute Operation zu verzichten. Hat sich die Erkrankung soweit ausgebreitet, dass eine Heilung nicht mehr wahrscheinlich ist, beginnt die Palliativtherapie. Dabei geht es primär darum, Tumorwachstum und -ausbreitung zu verlangsamen, Beschwerden zu minimieren und die Lebenszeit der Patientin bei gleichzeitiger Erhaltung der Lebensqualität zu verlängern.

Dem Risiko für Eierstockkrebs begegnet man am besten durch gezielte Vorsorgeuntersuchungen, denn wenn Symptome auftreten, ist er oft schon weit fortgeschritten. Typische Anzeichen sind unklare Schmerzen im Bauchraum, Verdauungsbeschwerden, Zunahme des Bauchumfangs, vermehrter Harndrang oder auch Blutungen. Die Ursachen für das Auftreten des Ovarialkarzinoms sind nicht vollständig geklärt. Sicher ist aber, dass Schwangerschaften oder die Einnahme der Pille das Risiko, am Ovarialkarzinom zu erkranken, senken.
